Wohnmobil-Hersteller werben mit unterschiedlichsten Technologien für den Wohnmobil-Aufbau und deren Vorzügen. Die Marketing-Terminologien machen den Wohnmobil-Kauf aber absolut undurchsichtig. Jeder Hersteller erfindet seine eigenen Begriffe, und am Ende weiß man als Kunde nicht mehr, was man eigentlich kauft. Während der Aufbau eines Wohnmobils in den Grundzügen immer ähnlich ist, unterscheiden sich die im Wohnmobil verwendeten Aufbau-Technologien, und beeinflussen doch wesentlich die Qualität und Wohnraumeigenschaften des neuen Wohnmobils. Zeit, dem Thema Wohnmobil-Aufbau unsere Aufmerksamkeit zu widmen.
Inhalt
Was ist der „Wohnmobil-Aufbau“ eigentlich?
Vom Wohnmobil-Aufbau spricht man, um all das zu bezeichnen, was über das jeweilige Basisfahrzeug des Wohnmobils hinausgeht. In anderen Worten ist der Wohnmobil-Aufbau also das, was vom Wohnmobil-Hersteller gebaut wird (während das Basisfahrzeug ja von einem gewöhnlichen Fahrzeughersteller wie Fiat, Citroen oder Mercedes-Benz geliefert wird).
Was damit genau gemeint ist, hängt von der Wohnmobil-Type ab.
- Beim Teilintegrierten oder Alkoven wird die Fahrer-Kabine und das Fahrgestell des Basisfahrzeugs beibehalten, und darauf ein Aufbau gebaut.
- Vollintegrierte Wohnmobilewird auch das Fahrerhaus als Teil des Aufbaus vom Wohnmobil-Hersteller gebaut.
- Beim Kastenwagen bleibt die Karosserie des Basisfahrzeugs erhalten, und der Aufbau beschränkt sich auf den Innen-Ausbau des Laderaums.
Wie ein Wohnmobil aufgebaut wird
Ein Wohnmobil-Aufbau wird grundsätzlich aus
- Bodenplatte
- Seitenwänden
- Dach
- Gerüst/Fachwerk
- Dämmung
- Innenverkleidung
- Möbeln
zusammengesetzt.
Der Aufbau von Alkoven, Vollintegrierten und Teilintegrierten
Je nach Wohnmobil-Typ gibt es hierbei leichte Abweichungen. So wird zum Beispiel beim Vollintegrierten auch das Fahrerhaus neu aufgebaut, während es bei den übrigen Bauweisen vom Basisfahrzeug übernommen wird.
Der Aufbau des Kastenwagens
Insbesondere der Kastenwagen benötigt keinen separaten Aufbau aus Seitenwänden und Dach, da hierfür ja die Blechkarosserie des Basisfahrzeugs genutzt wird. Dennoch benötigt auch ein Kastenwagen eine gerade und gedämmte Bodenplatte, gedämmte Seitenwände und Dämmung unterm Dach. Lediglich die Außenhaut ist dann jeweils Stahlblech. Dennoch könnte man behaupten, dass der Kastenwagen keinen Wohnmobil-Aufbau hat.
Der Wohnmobil-Aufbau als Auswahlkriterium beim Wohnmobil-Kauf?
Grundsätzlich ist zum Wohnmobil-Aufbau zu sagen, dass er meist eher Ausschluss-Kriterium als Auswahl-Kriterium ist. Mann kann zum Beispiel entscheiden, dass man einen holzfreien Aufbau wünscht, und damit jene Hersteller, die einen solchen nicht bieten, aus der Auswahl eliminieren. Davon abgesehen sind aber meist andere Kriterien, wie Grundriss, Features, Größe, Gewicht, Preis wichtiger.
Ich denke, es kommt nur selten vor, dass man zwei völlig identische Fahrzeuge findet, die den eigenen Ansprüchen in jedem Detail gleich gerecht werden. Dann hätte man den Luxus, die Aufbau-Technologien im Detail vergleichen zu können – ansonsten muss man ohnehin nehmen, was der Hersteller bietet.
Viele Hersteller bieten – je nach Modell und Preislage – mehrere Aufbau-Varianten, doch hat man sich auf ein Modell verständigt, muss man mit dessen Aufbau meist auch leben.
Materialien für den Wohnmobil-Aufbau
Für das Wohnmobil-Dach sowie die Seitenwände werden grundsätzlich drei verschiedene Materialien verwendet:
- Stahlblech
- Alu oder
- GFK
Stahlblech beim Kastenwagen
Stahlblech wird nur beim Kastenwagen verwendet. Die Blechkarosserie des Basisfahrzeugs wird dabei übernommen.
Das hat folgende Vorteile:
- Hervorragender Blitzschutz
- Guter Schutz bei Unfällen durch stabile Karosserie
- Verschweißte Blechteile sind wenig anfällig für Feuchtigkeitsschäden
Doch das Übernehmen der Karosserie hat auch Nachteile:
- Die Seitenwände sind nicht gerade und weisen Ausbuchten auf. Das schränkt den Platz im Inneren ein und zwingt den Ausbauer zu aufwendigen “Workarounds” um gerade Flächen zu erzeugen und Möbel anzubauen.
- Kastenwagen-Karosserien sind schmäler als andere Wohnmobil-Aufbau-Varianten.
- Stahlblech ist schwer, weshalb Kastenwagen im Gegensatz zur Erwartung vieler Neu-Käufer nicht leichter sind, als beispielsweise Teilintegrierte.
Alublech am Wohnmobil
Bei Teilintegrierten, Vollintegrierten und Alkoven-Mobilen wurde und wird oft Alublech für den Wohnmobil-Aufbau eingesetzt. Insbesondere Außenhaut und Dach werden damit verkleidet.
Bei Alu gibt es die Varianten
- Glattblech oder
- Hammerschlagblech.
Hammerschlagblech ist jenes Material, das man von Wohnwagen kennt. Charakteristisch ist die genoppte Struktur. Heute findet man Hammerschlagblech aber eigentlich (leider) nur mehr beim Wohnwagen, aber nicht mehr beim Reisemobil. Glattblech ist optisch schöner anzusehen, weshalb es von Wohnmobil-Herstellern bevorzugt wird.
Hammerschlagblech hat aber den Vorteil, für die gleiche Stabilität mit geringerer Materialstärke als Glattblech auszukommen. Das wäre für Wohnmobile und ihrer Gewichtsproblematik eigentlich keine schlechte Wahl. Der Nachteil von Hammerschlagblech ist, dass es aufwendiger zu pflegen ist, als Glattblech, und bei Schäden schwieriger zur reparieren. Zudem kann man keine Saugnäpfe daran befestigen (z.B. den Multianker zur Markisen-Befestigung).
Glattblech ist schwerer, als Hammerschlagblech, und man sieht Dellen viel deutlicher. Optisch ist es im Vorteil, was aber natürlich Geschmackssache ist.
Vorteile von Alu am Wohnmobil
Alublech hat gegenüber Stahlblech und GFK einige Vorteile:
- Alu rostet nicht
- Bei Gewitter und Blitzschlag ist ein Alu-Aufbau sehr sicher, da Alu sehr gut leitfähig ist.*
- Alu ist leichter als GFK und Stahlblech
*Vielen tun das als unwahrscheinlich ab. Doch mein Onkel wurde durch Blitzschlag getötet, insofern bin ich da etwas vorbelastet, und das Kriterium erscheint mir relevant.
Nachteile von Alu am Wohnmobil
Ein paar Nachteile von Alu am Wohnmobil gibt es natürlich auch.
- Empfindlich bei Hagel,
- Reparaturen sind teuer.
- Gefahr von Alufraß.
Was ist Alufraß am Wohnmobil?
Alufraß ist eine Reaktion von unterschiedlichen Metallen, bei denen das weniger edle der zwei Metalle korrodiert. Man erkennt es an Pickeln und später Löchern, deren Reparatur sehr aufwendig und teuer ist.
Warum tritt Alufraß beim Wohnmobil auf?
Zu Alufraß kommt es meist nach Undichtigkeiten, da das eingedrungene Wasser plötzlich eine leitende Verbindung herstellt, wo vorher keine war. Dann können plötzlich das Alublech der Außenhaut und eine Stahlschraube, mit der ein Möbelstück angeschraubt ist, miteinander reagieren. Auch Silikon kann Alufraß erzeugen.
GFK-Aufbau beim Wohnmobil
GFK wird als moderner Werkstoff für den Wohnmobil-Aufbau angepriesen. Er ist günstiger als Alu, und findet sich daher bei vielen Wohnmobilen der günstigeren Preisklasse.
Vorteile von GFK
Ein GFK-Aufbau ist relativ einfach zu reparieren.
- Empfang (GPS u.ä.) besser im Innenraum.
- GFK ist unempfindlich bei Hagel,
- Kann nicht korrodieren
- Günstig
- moderner Look
Nachteile eines GFK-Aufbaus
GFK ist nicht das Allheilmittel, als welches es von manchen Wohnmobil-Herstellern angepriesen wird. Zu den Nachteilen zählen:
- Kein Blitzschlagschutz
- Schwerer als Alu
- Zwar grundsätzlich hagel-unempfindlich, sehr große Hagelkörner können das Material zum bersten bringen und unbemerkt zu Haarrissen führen.
- Am Wohnmobil verwittert und vergilbt GFK unter UV-Einstrahlung
- GFK wird an der Außenseite durch einen sogenannnten „top coat“ geschützt. Wird diese Schutzschicht beschädigt wird, kann es außerdem zu teuren Osmose-Schäden kommen. Durch Haar-Risse (z.B. auch durch Hagel verursacht) kann Wasser eindringen.
GFK Pflege im Wohnmobil
Einen GFK-Aufbau eines Wohnmobils sollte man mit speziellen Reinigern pflegen. Das GFK des Wohnmobil-Aufbaus kann man damit einfach reinigen, doch am Besten erkundigt man sich nach der Kompatibilität beim Hersteller.
Um GFK zu reinigen sollte man natürlich weiche Schwämme benutzen, um Kratzer zu vermeiden.
Auch gegen vergilbtes GFK gibt es im Yacht-Bedarf GFK-Pflegemittel.
Der Boden im Wohnmobil
Jeder Wohnmobil-Aufbau braucht einen Boden.
Die Bodenplatte im Wohnmobil ist aus mehreren Gründen wichtig:
- Niemand möchte auf dem nackten Blech eines Kastenwagens wohnen, also soll die Bodenplatte des Wohnmobils für Wohnlichkeit sorgen. Beim Kastenwagen kommt der Bodenplatte außerdem die Funktion zu, den unebenen Blech-Boden des Kastens zu einer ebenen Fläche werden zu lassen.
- Die Wohnmobil-Bodenplatte ist außerdem aber auch die Basis für die Möbel und Trennwände, und muss daher entsprechend stabil sein.
- Drittens soll das Wohnmobil natürlich auch zum Untergrund hin gedämmt sein, der Konstruktion der Bodenplatte im Wohnmobil kommt also auch eine Wärmedämmungs-Funktion zu.
Woraus besteht die Wohnmobil-Bodenplatte?
Der Boden besteht meist aus drei Komponenten:
- Einem Belag, für Optik und Wohnlichkeit (PVC, Teppich, o.ä.)
- Der eigentlichen Platte für die Stabilität
- Isolierung/Dämmmaterial dazwischen
Je nach Bauweise können auch stabilisierende Elemente (Kunststoff-Profile o.ä.) zum Einsatz kommen.
Die Sandwichplatte
Die genannten Elemente aus Belag, Dämmaterial, Stabi-Elementen und Grundplatte wird zu einer sogenannten „Sandwich-Platte“ zusammengefügt.
Einfache Varianten (zum Beispiel von Selbst-Ausbauern) benutzen Pressspanplatten, hochwertige Bodenplatten der größeren Hersteller bestehen aus Sandwichkonstruktionen. Teils wird dabei Holz eingesetzt, doch auch GFK-Sandwich-Konstruktionen sowie Alu-Konstruktionen finden sich bei jenen Herstellern, die auf holzfreien Aufbau Wert legen. Beispiele findest du bei Promobil.
Die Bodenplatte vor Feuchtigkeit schützen
Bei der Bodenplatte ist es relativ wichtig, dass sie keine oder kaum Feuchtigkeit aufnimmt, denn durch Schuhe und nasse Füße, beziehungsweise auch einfach durch die Atemluft würde sie sich sonst bald verziehen.
- Beim Kastenwagen liegt unter der Bodenplatte der Stahlblech-Boden der Karosserie, der die Bodenplatte schützt.
- Bei allen anderen Wohnmobilen-Arten ist die Bodenplatte direkt den Elementen ausgesetzt, weshalb die Holz-Varianten mit Unterbodenschutz gegen Nässe geschützt werden müssen. Dieser Unterbodenschutz muss regelmäßig überprüft, und ggf. erneuert werden – schließlich kann er durch Steinschlag u.ä. leicht beschädigt werden. Viele Hersteller verpflichten ihre Kunden im Rahmen der Dichtheitsprüfung ohnehin dazu.
Der Belag der Bodenplatte
Für den Belag wird meist PVC oder Laminat verwendet.
Beim Belag bietet sich im Winter Teppich an, da er ein gemütliches Ambiente schafft. Allerdings ist er auch schmutzempfindlich und muss häufig gereinigt werden. Eine Variante ist, sich passengenaue Teppichstreifen zuzuschneiden, die man im Winter ins Wohnmobil legen kann.
Das Wohnmobil-Dach
Beim Wohnmobil-Aufbau darf natürlich ein Dach nicht fehlen. Auch beim Dach kommen wieder Alu oder GFK zum Einsatz. Die Ausnahme stellt wieder der Kastenwagen dar, bei dem das Stahlblech des Basisfahrzeugs beibehalten wird.
Es gibt mittlerweile auch Hybrid-Konstruktionen mit Kastenwagen-Karosserie aber GFK-Dach. Hersteller sind zum Beispiel Pössl oder Globe-Traveller.
Beim Dach gelten im Prinzip die gleichen Vor- und Nachteile wie im Abschnitt über die Materialien für die Außenhaut erläutert.
Stahlblech-Dach
Das Stahlblech-Dach eines Kastenwagens ist stabil und schützt vor Blitzschlag. Es bietet außerdem bei Unfällen einen gewissen Schutz.
Leider ist es auch schwer. Zudem ist es nicht gerade, was den Platz im Inneren einschränkt sowie die Verkleidung und den Möbelbau erschwert. Es kann außerdem Rosten, wenn der Lack beschädigt wird.
Alu-Dach am Wohnmobil
Ein Alu-Dach ist leichter als GFK oder Stahl. Alu vergilbt nicht, kann aber von Alufraß betroffen sein. Es kann nicht rosten und schützt vor Blitzschlag.
Dafür ist es teurer, und anfällig für Dellen (zum Beispiel bei Hagel). Reparaturen sind teuer. Es kann außerdem (bei Feuchtigkeitseintritt) zu Alufraß kommen, wenn die GFK-Dachbeschichtung in Mitleidenschaft gezogen wurde (zum Beispiel durch sehr große Hagelkörner).
Ein Wohnmobil-GFK-Dach
Ein GFK-Dach wird von vielen Wohnmobil-Herstellern für den Wohnmobil-Aufbau eingesetzt. Oft auch in Kombination mit Aluminium-Seitenwänden.
Ein Wohnmobil-GFK-Dach wiegt mehr als Aluminium, dafür ist GFK günstiger und hat kein Problem mit Alufraß oder Rost. Es ist unempfindlich gegenüber Hagel. Lediglich bei heftigen Schlägen kann es zu Haarrissen im GFK und Wassereintritt kommen. Kosmetische Schäden lassen sich bei GFK recht einfach reparieren.
Manchmal gibt es sogar eine Kombination aus Alu und GFK, wo die GFK-Beschichtung als Schutz gegen Hagel dient.
Isolierung GFK-Dach
Auch ein GFK-Dach muss natürlich auch gedämmt werden. Die Wohnmobil-Dach-Isolierung unterscheidet sich im Wesentlich nicht von der Isolierung der Seitenwände. Dazu mehr unter “Dämmung”
GFK-Dach am Wohnmobil begehbar
Begehen von GFK-Dächern sollte man vermeiden, da durch die dabei auftretenden Spannungen Undichtigkeiten die Folge sein können.
Wohnmobil GFK Dach reinigen
Da man ein Begehen eines GFK-Dachs vermeiden soll, ist für die Reinigung des Dachs eine Leiter sowie eine ausreichend langer Teleskop-Besen nützlich.
Verbindung von Wohmobil-Dach und Wohnmobil-Seitenwände
Dach und Seitenwände werden beim Wohnmobil meist mit Profilen miteinander verklebt oder verschraubt.
Bei einem schwimmend verlegten Dach wird die GFK oder Alu-Außenhaut nicht mit der Isolierschicht verklebt befestigt, sondern nur am Rand verspannt. Schwimmend verlegte Dächer sind ein Problem, wenn man Dachträger für Boote oder Surfboards befestigen möchte. Außerdem kommt es Berichten zufolge zu Wellenbildung.
Wohnmobil-Seitenwände
Beim Kastenwagen ist die Wohnmobil-Außenwand schnell erklärt: Die Seitenwände bestehen hier aus dem Stahlblech der Karosserie. Das ist stabil, schützt bei Blitzschlag und ist weniger anfällig gegen eindringende Feuchtigkeit.
Bei den übrigen Wohnmobil-Typen werden die Wände des Aufbaus nach verschiedenen Methoden aufgebaut.

Die Außenwand des Wohnmobils besteht dabei entweder aus
- Alu oder
- aus GFK.
Die Vor- und Nachteile dieser Materialien wurden bereits im Abschnitt über GFK und Alu erläutert.
Dahinter befindet sich dann Dämmmaterial, sowie oft eine Streben-Struktur für die Stabilität, bevor dann im Inneren die Verkleidung folgt.
Wohnmobil-Holzaufbau
Lange Zeit bestand der Wohnmobil-Aufbau der meisten Wohnmobile aus einem Holzgerüst („Holzfachwerk) das mit Styroporplatten gefüllt, und anschließend verkleidet wurde. Innen mit Sperrholz, außen mit Alu oder GFK.
Heute werden viele Wohnmobile mit einem „holzfreien Aufbau“ beworben, wo auf einen Wohnmobil-Holzaufbau verzichtet wird. Dennoch gibt es v.a. in der günstigen Preisklasse weiterhin Holzfachwerke. Ist Holz also ein schlechtes Material?
Nein, nicht grundsätzlich. Es ist güntig, flexibel und einfach zu verarbeiten, natürlich, hat gute, statische Eigenschaften. Allerdings verträgt es sich bekanntlich nicht gut mit Wasser. Das ist der Grund, warum Holz in Verruf geraten ist: Solange alle Verkleidungen, Nähte und Dichtungen wie vorgesehen funktionieren, gibt es mit Holz kein Problem. Probleme entstehen, wenn es einen Feuchtigkeitsschaden gibt, insbesondere, wenn dieser über längere Zeit unbemerkt bleibt. Dann fängt Holz nämlich an zu modern und zu morschen. Dafür genügen relativ geringe Mengen an Wasser, die irgendwo eindringen und nicht mehr trocknen können. Solcherart beschädigte Wohnmobile sind dann oft wirtschaftliche Totalschäden, denn unbemerkt entstehen solche Schäden eher nicht an Kästchen, die man einfach tauschen könnte, sondern im Gerüst oder Fußboden. Dort sind sie oft unmöglich wirtschaftlich zu beheben.
Wer also ein Wohnmobil mit Holzgerüst hat, muss deshalb nicht verzweifeln: Solange kein Wasser eingedrungen ist, ist die Holzkonstruktion unproblematisch. Allerdings sollte man hier noch mehr als ohnehin üblich regelmäßig auf Feuchtigkeit kontrollieren.
Vor und Nachteile eines Wohnmobil-Holzaufbaus
Zu den Nachteilen des Wohnmobil-Holzaufbaus gehören:
- Das Holzfachwerk ist bei Wasserschäden gefährdet, und kann morschen. Das entspricht dann oft einem wirtschaftlichen Totalschaden.
- Auch sind andere, modernere Aufbau-Technologien wohl etwas stabiler.
- Zudem entsteht bei Temperaturänderungen das Problem, dass Holz, Styropor, Alu unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, was dann zu Spannungen im Aufbau führen kann.
Doch ein Wohnmobil-Holzaufbau hat auch Vorteile:
- Es ist relativ leicht
- Möbel können am Holzfachwerk unkompliziert angeschraubt werden. Bei alternativen Bauweisen ist dies oft schwieriger.
- Kleinere Reparaturen können oft auch selbst durchgeführt werden, wenn man mit Holz umgehen kann.
Holzfreier Aufbau im Wohnmobil
Mit einem holzfreien Aufbau werben viele Hersteller – was genau dahintersteckt, unterscheidet sich. Allen gemein ist, dass ohne Holz das Risiko von morschen Aufbauten durch Wasserschäden beträchtlich reduziert werden kann. Das Holzfachwerk wird daher vermieden.
Man spricht vom Aufbau von Sandwichplatten, weil verschiedene Materialien (Außenhaut, Dämmaterial, Verkleidung) zu einer Einheit kombiniert werden.
Bei Hymer werden zum Beispiel eine Alu-Außenhaut sowie eine Alu-Innenhaut gegen dazwischenliegenden Schaum gepresst und so zu einer Einheit verbunden. Dadurch benötigt es keine Holzelemente, und man erhält eine sehr gut gedämmte Wohnmobil-Wand. Andere Hersteller gehen ähnlich vor, verkleben aber Außenhaut mit Dämm-Elementen.
Im Prinzip werden also beim holzfreien Wohnmobil-Aufbau auch die Holz-Streben durch andere Methoden und Materialien (zum Beispiel Kunststoffleisten) ersetzt. Im Inneren des Wohnmobils kommt für den Möbelbau nämlich weiterhin Holz zum Einsatz.
Die Wohnmobil-Außenhaut reparieren
Was, wenn die Wohnmobil-Außenhaut beschädigt ist, und repariert werden muss?
Eine Wohnmobil-GFK-Reparatur
GFK ist ein Standard-Werkstoff, und eine Vielzahl von Werkstätten können bei Reparaturen weiterhelfen. Man findet auf Facebook Bilder von Reparaturen in Hinterhof-Werkstätten Marokkos, die die Wohnmobil-Außenhaut reparieren konnten.
Hammerschlagblech reparieren
Leider sehr aufwendig ist die Reparatur von Hammerschlagblech. Um Hammerschlagblech zu reparieren, ohne die Reparatur nachher sofort zu sehen, ist ein spezialisierter Fachbetrieb erforderlich.
Bei großen Schäden kann den dortigen Angabe zufolge günstiger sein, die komplette Außenheut zu erneuern.
Die Wohnmobil Dämmung
Ein Artikel über den Wohnmobil-Aufbau darf die Wärmedämmung nicht ausklammern. Ganz wichtig ist die Wohnmobil-Dämmung für das Wohlbefinden an Bord: Ohne Wärmedämmung im Wohnmobil hätte man nicht nur im Sommer einen heißen Wohnmobil-Innenraum, sowie im Winter hohe Heizkosten und eine kalte und zugige Umgebung, sondern auch Probleme mit Kondenswasser an den kalten Außenwänden.
Für die Wohnmobil-Dämmung werden verschiedene Materialien eingesetzt. Wichtig für die Dämmung im Wohnmobil sind folgende Faktoren:
- Wohnmobil-Dämmstoffe sollen kein Wasser aufnehmen
- Die Wohnmobil-Isolation gelingt nur dann, wenn der Dämmstoff auch an der Außenwand anliegt. Daher ist es wichtig, dass der Dämmstoff flexibel zu verarbeiten ist.
- Die Wärmedämmung an sich ist natürlich wichtig
- Kosten: Es gibt teurere und günstigere Dämmstoffe fürs Wohnmobil
Hygroskopische Dämmstoffe
Hygroskopische Dämmstoffe nehmen Wasser auf. Dazu braucht es nicht unbedingt einen Wasserschaden: Luftfeuchtigkeit genügt.
Das kann zu Problemen führen:
- Wenn Wasser zum Beispiel an ein Holzfachwerk abgegeben wird, dann wird das Wasser lange nach innen gezogen, während äußerlich eventuell gar kein offensichtliches Problem ersichtlich ist. Wenn man den Schaden dann endlich bemerkt, ist es eventuell zu spät, und das Holzfachwerk ist bereits vermorscht.
- In Verbindung mit Stahlblech kann Wasser zu Rost führen
- Zusammen mit einer Alu-Außenhaut kann Alufraß auftreten
Hygroskopische Dämmstoffe sind beispielsweise:
- Styropor
- Steinwolle
Wenn ein Dämmmaterial kein Wasser weiterleitet, sieht man einen Wasserschaden sofort dort, wo er entsteht. Wenn dann noch die Aufbau-Konstruktion aus Kunststoff besteht, kann nicht mehr viel passieren. Dämmmaterial fürs Wohnmobil sollte daher kein Wasser aufnehmen können.
EPS-Schaum oder Styropor im Wohnmobil
EPS steht für „expandierter Polystyrol-Partikel-Schaum“ und ist besser bekannt unter BASFs Markennamen „Styropor„. EPS ist ein aus Erdöl hergestellter Dämmstoff. Er hat gute Wärmedämmungseigenschaften, lässt sich aber nicht in jede Form biegen und ist deshalb als Dämmmaterial fürs Wohnmobil nicht die erste Wahl. Es wurde aber lange Zeit gerne verwendet und wird auch heute noch von einigen Herstellern verbaut. Bei geraden Wänden eignet es sich grundsätzlich zur Deckenverkleidung im Wohnmobil sowie zur Isolierung der Seitenwände.
Nimmt Styropor Wasser auf? Die Antwort ist leider: Ja. Als Dämmstoff im Wohnmobil lässt sich Styropor daher eigentlich nicht empfehlen, zumal es heute bessere Alternativen gibt. Falls man dennoch Styropor verwendet, ist die Verwendung einer Dampfsperre notwendig.
Aus persönlicher Erfahrung können wir den Nachteilen noch hinzufügen, dass Styropor quietscht, wenn es gegen Styropor gerieben wird. Das kann im Wohnmobil unglaublich nerven, und lässt sich oft nicht beheben.
XPS im Wohnmobil als Dämmmaterial einsetzen
XPS steht für extrudiertes Polystyrol, auch bekannt als Styrodur. Während man bei Styropor die einzelnen Kügelchen erkennt und herauslösen kann, hat Styrodor eine Schaumstruktur ähnlich einer Gymnastik-Matte/Isomatte. XPS ist geschlossenporig und nimmt daher kein Wasser auf. Es ist daher gegenüber Styropor für die Wärmedämmung im Wohnmobil klar zu bevorzugen.
Man erkennt XPS daran, dass es meist gefärbt ist.
Dämmung im Wohnmobil mit Xtrem-Isolator: PE
Mit dem sogenannten Xtrem-Isolator kamen wir erstmals in Berührung, als wir unseren Bulli nachisolieren wollte. Dieser war noch mit Steinwolle isoliert, die wir dort, wo wir dafür nicht die Möbel entfernen mussten, durch Xtrem-Isolator ersetzten.
Eigentlich lautet die korrekte Bezeichnung PE: Polyethylen. Im Wohnmobil-Dämmung ist der Markenname „Xtrem-Isolator“ sehr bekannt, bzw. der Name „Trocellen Classic“.
Dieser aufgeschäumte Kunststoff ist fürs Wohnmobil eigentlich ideal. Er dämmt nicht nur Wärmeverlust ein, sondern wirkt auch geräuschdämmend. Zudem lässt er sich flexibel verarbeiten und passt sich allen Wandformen an.
Xtrem-Isolator nimmt dank seiner geschlossenen Poren kein Wasser auf. Das Material fühlt sich ein wenig wie eine Yoga-Matte oder Camping-Iso-Matte an, die man vom Zelten kennt.
Wohnmobil-Dämmung mit Armaflex
Armaflex ist ein beliebter Wohnmobil-Dämmstoff. Eigentlich handelt es sich dabei um einen Markennamen für FEF (Flexibler Elastomerschaum), doch unter Campern ist Armaflex der geläufige Begriff.
Es handelt sich bei Armaflex um einen geschlossenporigen, synthetischen Kautschuk, der sich fürs Wohnmobil gut als Dämmstoff eignet.
Armaflex lässt sich flexibel verarbeiten und passt sich auch unebenen Wänden an. Zudem ist Armaflex selbstklebend, was im Wohnmobil sehr praktisch ist.
Polyurethan-Schaum für die Wohnmobil-Dämmung
PU, oder Polyurethan wird manchmal zum Ausschäumen von Holmen oder dämmen größerer Flächen verwendet. Es hat gute Dämmungs-Eigenschaften, ist aber sehr leicht entzündlich. Oft findet man PU in Kombination mit anderen Stoffen für gewisse, sonst schwer dämmbare Bereiche.
Steinwolle / Mineralwolle / Glaswolle
Auch wenn Mineralwolle bei vielen Herstellern bis vor gar nicht allzu langer Zeit für die Isolation des Wohnmobils quasi Standard war, ist sie eigentlich für Wohnmobile nicht geeignet. Die Wollfasern sinken nämlich durch das Rütteln während der Fahrt in sich zusammen, und so wird die Mineralwolle mit der Zeit zu einem Klumpen. Zwar gibt es wohl auch Varianten mit Bindemittel, die das besser lösen, doch es gibt weitere Gründe gegen Steinwolle:
Die Steinwolle kann Fasern an die Luft abgeben, die nicht gerade gesund sind. Zwar wird sie als Dämmaterial im Wohnmobil hinter Verkleidungen verbaut, doch 100% dicht sind diese nicht immer.
Zwar ist Mineralwolle nicht hygroskopisch, hat aber eine so geringe Dichte, dass Wassertropfen durch das Material dringen können. Das beeinträchtigt die Isolation des Wohnmobils schlussendlich und kann zu Rost an ungünstigen Stellen führen.
Als Dämmmaterial fürs Wohnmobil sollte man daher von Steinwolle eher Abstand nehmen.
Die Dampfsperre im Wohnmobil
Im Zusammenhang mit der Dämmung des Wohnmobils liest man auch immer wieder von der sogenannten Dampfsperre.
Bei der Dampfsperre im Wohnmobil geht es darum, dass verdunstetes Wasser, also Dampf, von dort ferngehalten wird, wo es nichts verloren hat, also zum Beispiel im hygroskopischen Dämmmaterial.
Dampf entsteht im Wohnmobil nicht nur beim Kochen, sondern bereits durch die Atemluft. Auch beim Trocknen von Kleidung, zum Beispiel beim Wintercamping, kann viel Feuchtigkeit von der Luft aufgenommen werden. Feuchtes Dämmaterial funktioniert nicht nur schlechter, sondern kann auch zum schwerwiegenden Schäden am Wohnmobil führen, zum Beispiel durch Schimmelbildung, oder (noch schlimmer) durch morsches Holz des Aufbaus.
Eine Dampfsperre ist meist einfach eine Kunststofffolie sein, die über das Dämmmaterial gezogen wird. Damit ist das Dämmmaterial vor Feuchtigkeit geschützt – jedenfalls, sofern die Folie nicht beim Anbauen der Möbel durchbohrt wurde.
Doch nicht jedes Dämmmaterial fürs Wohnmobil benötigt eine Dampfsperre: Materialien, die keine Feuchtigkeit aufnehmen, wie xtrem-Isolator, sind quasi bereits vor Feuchtigkeit geschützt. Das gilt jedoch nur, wenn auch die Verarbeitung stimmt, denn wenn irgendwo nacktes Blech zum Vorschein kommt, wird sich dort Kondenswasser bilden. Es ist daher wichtig, dass das Isoliermaterial auch überall direkt am Blech anliegt.
Möbelbau im Wohnmobil-Aufbau
Beim Wohnmobil-Aufbau ist natürlich auch der Möbelbau wichtig. Beim Möbelbau im Wohnmobil stehen drei Aspekte im Vordergrund:
- Stabile Bauweise
- Geringes Gewicht
- Ansprechende Optik
Stabile Bauweise der Wohnmobil-Möbel
Ein Wohnmobil ist in Bewegung, die Karosserie verwindet sich, und damit auch das Innenleben des Wohnmobil-Aufbaus. Deshalb müssen Möbel stabil konstruiert sein, um dieser Belastung über Jahre zu widerstehen.
Gewicht der Wohnmobil-Möbel
Auf der anderen Seite ist das Gewicht ein großes Problem vieler Wohnmobile. Allzu massive Möbelkonstruktionen sind daher nicht sinnvoll.
Bauweisen
Bei den Bauweisen verfolgen die Hersteller ihre eigenen Philosophien. Während ein Hersteller mit „Vollkorpus-Bauweise“ wirbt und deren Stabilität herausstreicht, preist ein anderer wiederum das Fehlen der Rückenteile und die damit einhergehende Gewichtsersparnis an. Hier gibt es wahrscheinlich kein Richtig oder Falsch, man sollte sich die Möbel ansehen und selbst bewerten.
Optik der Wohnmobil-Möbel
Schlussendlich müssen die Möbel natürlich auch noch gefallen. Bei der Optik der Wohnmobil-Einrichtung hat sich in den letzten Jahren viel getan, und man findet heute kaum mehr altmodische Einrichtungen.
Hier sollte man natürlich dem eigenen Geschmack entsprechende Hölzer und Furniere wählen. Während man Sitzbezüge und Vorhänge auch mal ändern kann, ist man an die Optik der Möbel im Prinzip gebunden.
Es empfiehlt sich, auch keine besonders auffälligen Designs zu wählen, an denen man sich vielleicht nach einer Saison sattgesehen hat.

Hinterlüftung der Wohnmobil-Möbel
Ein objektiver Vorteil ist sicherlich die Hinterlüftung der Möbel, die von vielen Herstellern angeboten wird. Dabei gibt es an der Hinterseite der Wohnmobil-Möbel Lüftungskanäle. Das verhindert einen Kältestau und Feuchtigkeit an unzugänglichen Stellen.
Qualität der Kleinteile
Schlussendlich sind noch die Kleinteile ein relevantes Qualitätskriterium. Scharniere aus Metall wiegen zwar mehr, versprechen aber eine lange Lebensdauer.

Fazit zum Wohnmobil-Aufbau
Der Wohnmobil-Aufbau besteht aus Seitenwänden, Boden, Dach, Dämmmaterial und Möbeln. Als Materialien kommen Stahlblech, Alu und GFK zum Einsatz. Zur Wohnmobil-Isolation nutzt man eine ganze Reihe an Dämmstoffen. Wichtig dabei ist, dass der Dämmstoff kein Wasser aufnehmen kann. Die Möbel im Wohnmobil sind natürlich eine Geschmacksfrage, doch Gewicht und Stabilität dürfen nicht außer Acht gelassen werden.
Welche Erfahrungen hast du mit deinem Wohnmobil-Aufbau gemacht? Schreib doch einen Kommentar!
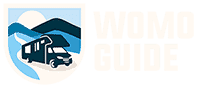









Schreibe einen Kommentar